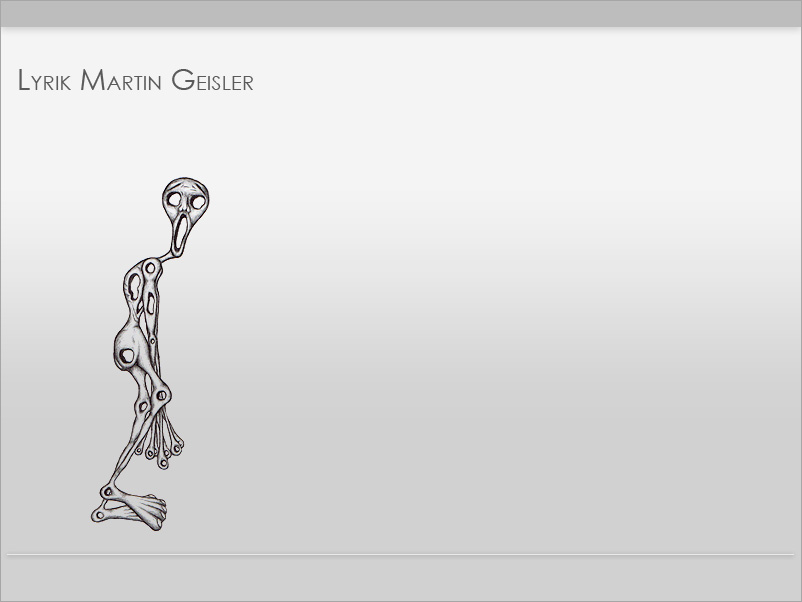Der beliebte Hahn
Als Max, der junge Hähnerich,
Zu je zwei Teilen lag am Tisch,
Das Federkleid bei Seit´ gelegt,
Die gelben Füßchen abgesägt,
Da wo noch jüngst sein Herzlein schlug,
Er in der Brust jetzt Möhrchen trug,
Und er den schönen Hahnenkamm
Verlor am harten Baumesstamm,
Da fiel ihm auf, dass manches Leben
Erst ohne Kopf beliebt gewesen.
Animalisches
Ich frag mich manche stille Stunde
Warum dreh ich als Mensch die Runde?
Warum kann ich nicht nebendrein
Denn noch ein anderes Leben sein?
Ja, ginge das, ich denk ich wär’
Ein großer dunkler Kuschelbär.
Oder vielleicht doch lieber noch
Ein Häschen in einem Hasenloch.
Auch würd’ mich mancher sehr beneiden
Könnt ich mich als ein Pferd verkleiden.
Warum nicht nur für einen Tag
dass ich als Hahn die Hühner mag?
Schon Zeus war klar was es so nutzt
Wenn man sich als ein Tier rausputzt
Denn wünscht sich manches junge Weib
Ein Tier in einem Männerkleid.
Tja, meine holde Damenschar
Hier steh ich jetzt so ganz und gar
Und bring von jedem wilden Vieh
Ein Stück der Frauenphantasie.
Das es zwar letztlich leider is’
Vom Has’ das Ohr, vom Pferd’s Gebiss
Und ich nur weiter dienen kann
Mit Hühnerbrust und Bärengang.
All das tut mir zwar schrecklich leid
Doch passt auch keiner Kuh das Kleid
Von einer Frau, die zart und fein
Nur andersrum kann’s schon mal sein.
Heldenlied
In einem tiefen, dunklen Loch,
Da lebt, man glaubt´s nicht, heute noch,
Ein gräuslich, graues Ungetüm.
Ich will erzählen euch von ihm.
Zwei Meter misst es von den Zehen.
Was sag ich? Pranken hab gesehen
Ich, als ich schlich auf seinem Pfade,
Uns zu befreien von der Plage.
So trat ich ein in seine Grotten,
Voll Heldenmut und unerschrocken,
Als es mit allerlei Gelärme,
Sich stürzen wollt auf meine Därme.
Von seinen elenlangen Beißern,
Tropfte der Schleim, doch ich blieb eisern,
und statt zu weichen vom dem Platze
Schlug ich dem Monster auf die Tatze.
Hernach, ihr ahnt es sicher schon,
begann ich´s Scheusal anzubohr´n.
Und als ich siegreich zog hinfort
Wart Glück und Freiheit jedem Ort.
Da schlug es sieben, ich wurd´ wach,
Schaute mich um und dachte nach,
Als voller Schrecken mir fiel ein,
Das Ungetüm liegt nebendrein.
Es ist vor vielen, vielen Wochen,
In einer Nacht zu mir gekrochen,
Als ich, ich muss es euch gestehen,
Etwas zu tief ins Glas gesehen.
Heut liegt es da, es nennt mich Mann
Und ich denk beinah täglich dran,
Das nicht der größte Heldenmut
Was nutzt, wenn brennt die Fleischesglut.
Der alte Esel
Es trägt seit vielen Jahren schon
Den Berg herauf für wenig Lohn
Ein alter Esel seine Last
Macht weder Urlaub oder Rast.
Schon wenn der junge Hähnerich
Den Morgen grüßt, der Tag noch frisch
Bewegt der alte Esel schon
Den schweren Sack zum Kirchendom.
Und wenn des Himmels Feuerball
Zur Nacht sich senkt und Bettenwahl
Steigt unser Esel, lahm und matt
Vom Berge schlapp ins Tal hinab.
So geht es jeden Tag auf Tag
Er steigt hinauf und abends ab
Blickt weder rechts noch links entlang
Kennt seinen Weg zum nächsten Gang.
Doch eines frühen Sommertags
Das Licht war rot, das Gras noch nass
Da war auf keinem von den Wegen
Etwas vom Esel noch zu sehen.
Der Tag verstrich, ganz still und heimlich
Und jeder merkte das da freilich
Ein irgendwas nicht richtig war
Doch was das war, war keinem klar.
Es ging ein Raunen durch die Gassen
Ein Flüstern, Rauschen oder Rascheln
Bis dann die Alltagsrhythmen kamen
Und alle Zweifel mit sich nahmen.
Erst als nach ein, zwei warmen Wochen
Ein schlimmer Duft herangekrochen
Von dort wo einst der Esel lebte
Da wussten sie, was ihn' so fehlte.
Doch sind wir ehrlich, unter uns
Zum Glück dass wir im faulen Dunst
Nach unserem Tod noch stinkig wären
Sonst würd’ sich keiner um uns scheren.
Das Schaf
Da steht das Schaf
Steht da
Das Schaf
Und kaut
Schon wieder
Wiederkaut´s
Das Schaf
Es kaut
Und schaut
Schaut drein
Schaut rein
Ins Loch
Ins Schwarz
Ins schwarze Loch
Und doch
Es kaut
Schon wieder
Wiederkaut´s
Das Schaf
Der Holzwurm Robinson
Auf einer Lichtung, hoch am Blick
Da steht schon lang, besonders chic
Ein einzig, riesengroßer Baum.
Doch wenn wir ihn von nah beschau'n
So wohnt, seit vielen Jahren schon
In ihm der Holzwurm Robinson.
Er nagt sich frisch, froh, fröhlich, frei
Denn ihm ist es ja einerlei
Durch´s morsche, mächtige Geäst
Macht sich ein wahres Freudenfest
Aus all den leckerlichen Dingen
Die diesen Baum am Leben zwingen.
Zwar hat's der schwere Eichenbaum
Schon längst bemerkt, doch juckt's ihn kaum
Dass dieser winzige Geselle
Sich schändlich hält an seiner Pelle.
Nun hätt' auch so ein Wurm zu kauen
Um solch' ein Baum ganz zu verdauen.
So leben beide schlecht und recht
Der kleine Herr, der große Knecht
Und wäre niemals nichts geschehen
Würd’ es vielleicht noch heut so gehen.
Doch ahnten beide jetzt noch nich’
Das diese Zeit schon bald verstrich.
Nur ein paar Jahre später war’s
Da lag der Eichenbaum im Gras.
Es hatten ihn, und das nicht sacht
Paar Männer hart zu Fall gebracht.
Nur war’s damit längst nicht vorbei
Sie sägten ihn noch ganz entzwei.
Dann schraubte, sägte, klebte einer
Und plötzlich stand, das glaubt mir keiner
Aus dem was einst ein Baum gewesen
Da Schrank, Tisch, Stuhl und noch ein Besen.
Das alles kaufte sich, per Maus
Herr Freitag für sein Elternhaus.
Bloß hatte Freitag nicht vernommen
Dass er für’s Geld noch mehr bekommen.
Weil in der lang’n Entstehungszeit
Da machte sich ein jemand breit
Und wer’s Gedicht von vorn gelesen
Der fragt wo Robinson gewesen.
Er harrte all der schlechten Zeiten
Im Holz aus, um sich zu verbreiten
Und sitzt jetzt glücklich, warm und fett
In Freitag’s neuer Maisonette.
So lebt, wie’s früher schon gewesen
Der Robinson auf fremde Spesen.
Auf diesem Weg hat uns bewiesen
Ein Wurm, wie’s Leben zu genießen.
Denn wer sich still geduckt verhält
Wenn eines and’ren Kopf gefällt
Der wird, wenn alle Henker ruhen
Schlicht weiter seine Sache tun.
Froschgedanken
Es sagte sich ein Frosch erschreckt,
Als er im Maul der Schlange steckt:
So end' ich hier auf dieser Wiese
Mit einer ernsten Daseinskrise.
Er dachte kurz zuvor bei sich,
Ganz angestrengt und schöpferisch:
Was könnte wohl, und sei’s nur klein,
Mein Sinn auf dieser Erde sein?
Vielleicht die Liebe und der Leich?
Vielleicht sein Abendlied am Teich?
Vielleicht der Jäger mancher Mücken
Oder einen Dichter zu verzücken?
Wie er so saß, bemerkt er nich'
Dass hinter ihm ne Schlange schlich.
Und als er grad mit Kant gedacht
Hat sie den ersten Biss gemacht.
Es dauerte noch etwas lang,
Wie ihn das Schlangentier verschlang.
Und da sie ihn von hinten fraß
Fiel ihm noch ein, was er vergaß.
Mitunter reicht zum glücklich Leben
Instinkte folgen und bewegen.
Für einen Frosch, fiel ihm noch ein
Kann denken sehr gefährlich sein.
Noch kurz bevor er ganz verschwand
In einer Schlangenmagenwand
Fing er sehr instinktiv
Ne Fliege, die statt flog eher lief.
Ich habe nicht mehr ausgemacht,
Woran die Fliege grad gedacht.
Vom Königsfalter
Auf einem See, versteckt im Wald
Wo nicht des Jägers Flinte knallt
Wo sich auch kein Tourist verirrt
Und sich kein Pärchen Liebe schwört
Kurz um; an dem die Welt so ist
Wie es ein jedes Tier vermisst.
Dort liegt, weil es ja niemand stört
Ein toter Baum, ganz unbeschwert
Quer in dem See, der selber rund
Und bietet so ein Aussichtspunkt
Für Vögel, Frösche und Insekt
Weil hier viel Kraft und Ruhe steckt.
Und heute, unterm Sonnenschein
Nennt jemand diese Wurzel sein
Der zweifelsfrei der Schönste ist
Der diesem Teich zu Throne sitzt.
Ein Schmetterling, voll Farbenpracht
Gelb-grünlich auch mit rot bedacht
Ziert dieses Bild, das schöner nicht
Die größten Maler hingekriegt.
So träumt der Falter vor sich hin
Verliert beim Wellenspiel den Sinn
Und keiner weiß wie er sich fühlt
Der selber nicht solch Land regiert.
Wie so der Königsfalter saß
Und rings die Welt um sich vergaß
Da sprang ein Fisch aus seinen Wogen
Und hat ihn in sein Maul gezogen.
Still blieb es - nur die Wellen
Zeugten vom Schicksal. Und Libellen
Sie ließen nicht viel Zeit vergehen
Um selber Stellung zu beziehen.
Der Fisch, der nun zufrieden war
Sah freilich nicht das Wunderbar
Der Teich, das Licht, das Farbenspiel
Aus Fischaugensicht nicht all zu viel.
So musst’ der Falter jäh erfahren
Dass sich so manche Untertanen
Nicht freuen an dem hellen Schein
Und nur gesättigt wollen sein.
Wie die Kuh im Schlachof
Treu und doof.
Etwas ängstlich schaut sie drein
Aber dann geht's doch hinein
In den großen, kalten Saal
In dem schon soviel vor ihr Mal
Das geschah, was nun geschehe.
Fletschend Messer, schlagend Klingen
Und das Blut läuft durch die Rinnen
Aber nüchtern, lieb und brav
Trabt die Kuh durch's warme Nass.
Ritschi, Ratschi an der Kehle
Und das Röcheln in der Nähe
Von der Kuh, die vor ihr steht
Deren Fleisch sich vor ihr regt
Die noch zuckt und dann verendet.
Vom Gesicht des Tods geblendet
Nun wohl wissend, was geschehe
Wird es still in ihrer Nähe.
Rechts und links droh'n hohe Wände
Und die Kuh ahnt schon das Ende.
Wie in Trance tritt sie heran
Jemand setzt den Bolzen an
Bums
Das war's wohl dann.
Sie spürt nicht, wie die Kehle schlitzt
Wie das Blut dann aus ihr spritzt
Wie der Haken in sie schlägt
Und ihren Körper wegbewegt.
Wehrlos und doch treu ergeben
Endet so das schöne Leben.
Doch vielleicht ist's besser so
Tot war sie ja sowieso.